Editorial
Dialogstrukturen partizipativer Prozesse

Editorial
Dialogstrukturen partizipativer Prozesse
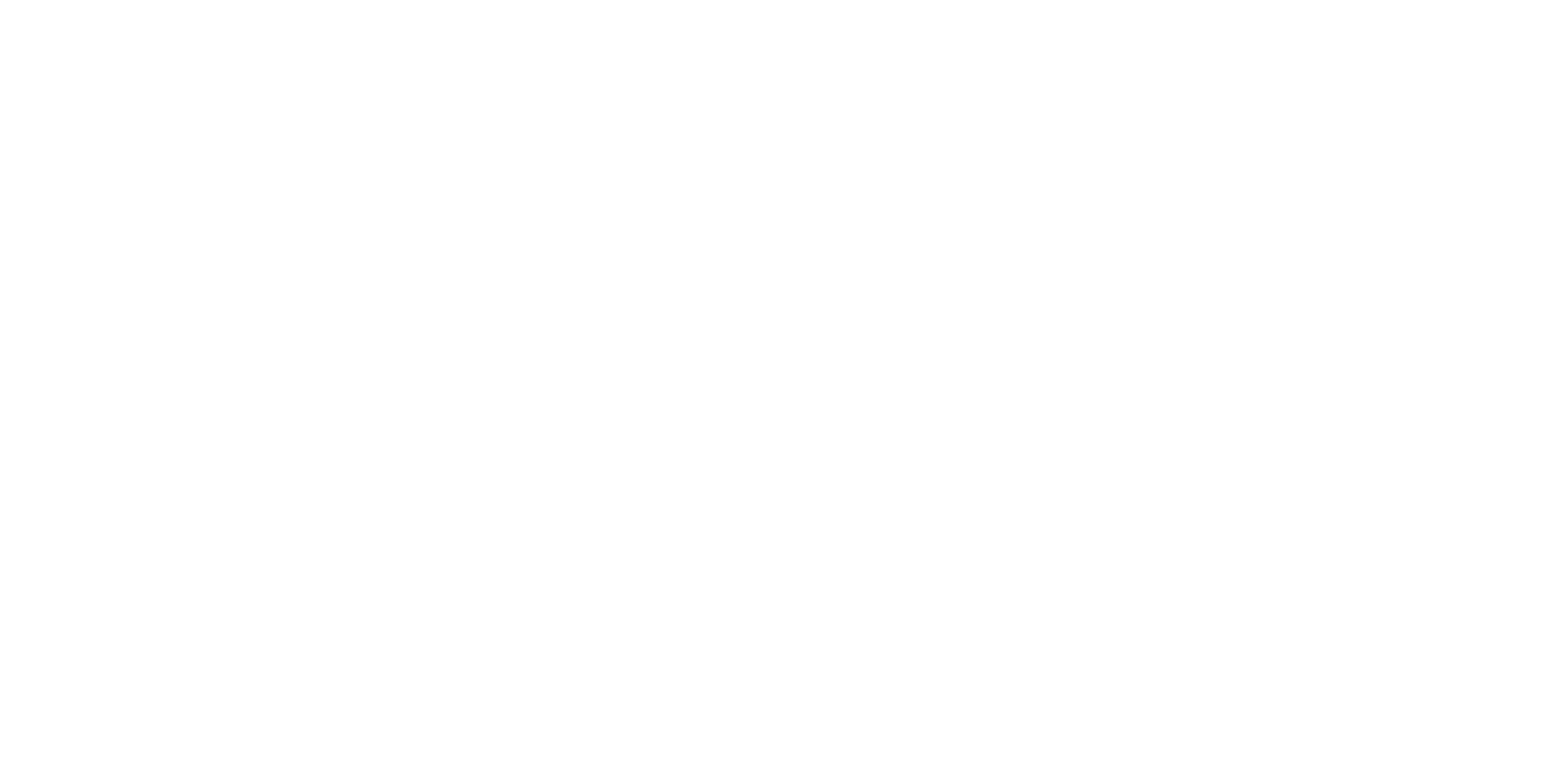
Das Team des Planungsbüros nonconform ist davon überzeugt, dass architektonische Interventionen die Visionen und Ideen ihrer Nutzer*innen widerspiegeln müssen. Diesen Stimmen Gehör zu verschaffen, den Dialog zwischen den Akteur*innen aufzubauen, den Austausch zu moderieren und den notwendigen Output zu identifizieren sind demnach Aufgaben, die die Entwurfsarbeit abrunden. “Wir schaffen nicht einfach Architektur, wir schaffen Möglichkeitsräume”, lautet das Credo von nonconform. Was das genau bedeutet, haben wir im folgenden Gespräch erkundet.

Wie entstand die nonconform Akademie? Wie strukturiert und vermittelt ihr euer Wissen?
Entstanden ist die Akademie in einer Phase des Bürowachstums und der Weiterentwicklung unserer partizipativen Formate. Wir widmeten uns intensiv der Retrospektive laufender und abgeschlossener Projekte anhand von Fallbeispielen aus der Praxis und probierten parallel verschiedene Formate aus, um unsere methodischen Fähigkeiten zu verbessern. An diesen Runden nahmen auch Personen aus dem erweiterten Büroumfeld teil, die betonten, dass dies eine Bereicherung für die Akteur*innen des täglichen Tuns sei, da Partizipation oft nur theoretisch vermittelt werde. Daraufhin entwickelten wir ein Curriculum und erhielten den Zuschlag von der Wirtschaftsagentur Wien für ein Forschungsprojekt. Dadurch konnten wir die Trainings verfeinern, strukturieren und eine Kommunikationsschiene aufbauen.
Herzstück ist das Lernen anhand der echten Praxis. Mit über 20 Jahren partizipativer Prozesserfahrung können wir jede Menge „Schmankerln“ – wie die Österreicher*innen gute Geschichten bezeichnen – liefern. Wir bieten den Teilnehmenden einen guten Mix aus Selbsterfahrung, Praxiswissen, Feedbackkultur und Diskussion und gehen individuell auf Wünsche und Projekte ein. Wichtig ist, dass es mindestens zweitägige Sessions sind. Das Reflektieren und darüber Schlafen ist für manche Erkenntnisse essenziell.

Und an wen richtet sich das Akademie-Format?
Es können sich alle bei uns melden, die ihren Methodenkoffer für partizipative räumliche Entwicklungen in Gemeinden, Städten, Schulen und Unternehmen erweitern möchten. Besonders gut klappen die sogenannten In-House-Schulungen für interessierte Teilnehmende aus Betrieben und Institutionen oder für Schulungsanbieter*innen wie Architektenkammern oder Regionalmanagements. Wir verzichten mittlerweile auf selbstinitiierte Weiterbildungstermine, weil das Organisatorische dahinter (Anmeldungsmanagement, Vermarktung usw.) nicht unsere Kernkompetenz ist. Stattdessen konzentrieren wir uns auf Content-Vermittlung und Training. Für einzelne Interessierte und spezifische Fragen bieten wir Individualcoachings an.

Wo werden Partizipation- und Dialogformate am meisten benötigt, wo sollten sie präsenter sein und häufiger eingesetzt werden?
Unserer Erfahrung nach gibt es Vorbehalte, ungewöhnliche Formate in den normalen Planungsalltag einzubinden. Es herrscht die Sichtweise, diese scheinbar „aufwendigen Methoden für gute Gespräche“ wären nur etwas für basisdemokratische Aushandlungssituationen mit der breiten Bevölkerung. Doch in unseren Akademien wird deutlich, dass viele dieser Methoden, Techniken und Kniffe auch in alltäglichen Meetings, Präsentationen, Verhandlungen oder im Projektmanagement hilfreich sein können. Sie helfen dabei, Teilnehmer*innen aus dem Alltagstrott und der passiven Komfortzone herauszuholen und zu aktiven Mitdenker*innen zu machen. Aus unserer Sicht sind diese Formate in jedem Aushandlungsprozess, der länger als eine halbe Stunde dauert sinnvoll.
Wir arbeiten nicht nur mit der breiten Bevölkerung, sondern überwiegend mit unterschiedlichen Stakeholdergruppen aus Institutionen, Unternehmen, politischen Gremien oder Verwaltung. Dabei ist das ergebnisorientierte Aufbrechen mancher Dynamiken oft sehr hilfreich.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, Planungsverfahren und Architekturwettbewerbe um die Perspektiven der Nutzenden zu erweitern. Wir konnten pilothafte Wettbewerbsverfahren mit Beteiligungsprozessen anreichern und positive Feedbacks von allen Seiten ernten.

Ihr habt Büros an verschiedenen Standorten in Österreich und Deutschland. Gibt es regionale Unterschiede, die sich in eurer Arbeit bemerkbar machen?
Die Unterschiede gibt es im „Kleingedruckten“ – allein schon wegen der kulturellen Sozialisierung. Wir schmunzeln oft darüber, weil sie intern manchmal für Verwirrung sorgen. Neben verschiedenen Bezeichnungen für dieselben Dinge – in Österreich heißt es „Mistkübel“, in Deutschland „Mülleimer“, in Österreich „Stiege“, in Deutschland „Treppe“, in Österreich „Sessel“, in Deutschland „Stuhl“ – verwenden in Deutschland alle eher das förmliche „Sie“, während in Österreich eher das informelle „Du“ üblich ist. Wir verwenden meist das sogenannte „Arbeits-Du“, was oft als Eisbrecher fungiert und für gute Stimmung sorgt.
In Deutschland ist die Planung wesentlich ausgeprägter, jedes noch so kleine Detail muss im Vorfeld wohlüberlegt werden. Es gibt Matrizen für alle Aufgaben, klare Zuständigkeiten und sehr viele Abstimmungen. Also ein ordentliches Paket an aufwendiger Organisationsarbeit mit vielen Zwischenrunden. In Österreich hingegen wird mehr auf Improvisation vertraut. Hier ist ein „passt schon“ oder „schauen wir mal, wird schon irgendwie gehen“ eine Art kulturelle Grundvoraussetzung. Mittlerweile sind wir in beiden Welten sehr gut eingespielt: Wir bringen die österreichische Lockerheit und Improvisation in Deutschland und die präzisiere Vorplanung in Österreich ein.

Kulinarik spielt in euren Verfahren eine besondere Rolle. Könnt ihr mehr dazu erzählen?
Es ist ganz simpel: Die meisten von uns können sich besser konzentrieren, wenn sie nicht hungrig sind. Satt sein senkt das Aggressionslevel deutlich. Essen tun wir alle und können uns recht unverfänglich darüber unterhalten. Das bringt die Leute zusammen. Wir integrieren also das Essen und Trinken in die Workshops und Werkstätten, so fühlen sie sich weniger wie Arbeit an. Außerdem: Gemeinsame Durchbrüche bei Lösungsfindungen sind immer auch Sinneserfahrungen. Am Ende eines Tages ist es doch ein wunderbares Gefühl, das Zischen beim Öffnen eines Erfrischungsgetränks nach der Schlussrunde miteinander zu zelebrieren.
Der Bildungsauftrag von nonconform besteht auch darin, das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen, weshalb ihr an dem „Klimakoffer“ arbeitet. Was ist damit gemeint?
Seit zwei Jahren gibt es bei nonconform das Klimafrühstück, eine interne Weiterbildung, bei der sich das gesamte Team der acht Standorte in Österreich und Deutschland jeden Donnerstagmorgen digital trifft. Wir sprechen einerseits über die aktuellen Projekte, aber es gibt auch Expert*innen-Inputs zu klimarelevanten Herausforderungen.
Mit diesen Erkenntnissen befüllen wir sukzessive unseren Klima-Wissensspeicher. Daraus entstehen wirksame Werkzeuge und Methoden zur Erreichung der Klimaneutralität in unseren Aufgaben, die wir im sogenannten Klimakoffer mitnehmen und unmittelbar anwenden. Wir haben keinen Anspruch an Vollständigkeit, sondern wollen diesen Wirksamkeits-Koffer durch Handeln und Anwenden kontinuierlich weiterentwickeln und verfeinern.

Welche Berufsprofile machen das Team von nonconform aus?
Unser Team hat größtenteils ein Studium im Planungskontext absolviert – Architektur, Raum-, Stadt- und Freiraumplanung. Aber auch Umwelt- und Bioressourcenmanagement sowie Soziologie gehören zum Bildungshintergrund der nonconformler*innen. Viele von uns haben zusätzlich postgraduale Aus- und Weiterbildungen im kommunikativen Bereich, in Mediation oder Pädagogik abgeschlossen. Dazu kommt, dass wir vielfältig engagiert sind – in bürgerschaftlichen Initiativen, der Kommunalpolitik oder in der Lehre an Hochschulen und Universitäten. Wo wir uns thematisch breiter aufstellen wollen: Soziale Arbeit, Projektentwicklung, Immobilienfinanzierung, Digitalisierung und Pädagogik.
Wie nehmt ihr die Vermittlung von Beteiligungsverfahren und Dialogformaten in der Hochschullehre wahr?
Die Ausbildung zum partizipativen Verständnis ist vor allem in den städtebaulichen und raumplanerischen Studiengängen integriert und weniger in der Architekturausbildung, obwohl letztere sukzessive Raum dafür schafft. Wenn wir selbst in der Lehre tätig sind, legen wir besonderen Wert auf gemeinschaftliches Entwickeln und Planen, also die Phase 0. Die Hochschulen bezeichnen diese Lehrveranstaltungen gerne „Prozessarchitektur“. Dabei lernen die Studierenden spielerisch Techniken und Methoden kennen, um das Wissen der Vielen für die Entwurfsarbeit abzuleiten. Die Rückmeldungen zu unserer Lehre sind vielversprechend. Die Studierenden saugen dieses Wissen auf, da es in der Regel nicht standardmäßig vermittelt wird, obwohl es im Studium täglich benötigt wird.
Worin bestehen die Schwierigkeiten der partizipativen Planung im Vergleich zur „konventionellen“?
Wir sehen partizipative Prozesse nicht als Schwierigkeit, sondern als Bereicherung für Planung und Entwicklung. Sie führen zu besseren, maßgeschneiderten Ergebnissen. Jedoch erfordern sie im Vorhinein ein klares Verständnis ihres Zwecks und Umfangs sowie die Auswahl der richtigen Methode. Es geht nicht darum, fachlich anspruchsvolle Aufgaben von Laien lösen zu lassen, sondern vielmehr um Vermitteln, um Transparenz, um das Begegnen auf Augenhöhe und um das Verständnis für die Vielfalt.

Wenn ihr auf eure Erfahrungen zurückblickt – gibt es ein Projekt, das wegen seines besonderen Verlaufs oder der beteiligten Akteur*innen hervorsticht?
Es gibt viele kleine wie große Projekte, auf die wir stolz sind und die wir auf der Website sowie in unserem Buchprojekt „mittendrin und rundherum“ zusammengefasst haben. Besonders erfreulich ist es für uns, wenn wir die Beteiligung über alle Phasen eines Projekts aufrechterhalten können – von der partizipativen Projektentwicklung über die Planung bis hin zur Besiedelung. Dies ist bei öffentlichen Auftraggebern aufgrund der Vergaberichtlinien oft nicht möglich, während es bei privaten Projekten leichter ist. Ziehen wir diese Parameter von der Phase 0 bis zur Phase 10 heran, entstehen Projekte wie das Bildungszentrum Pestalozzi in Leoben, das gemeinschaftliche Wohnen auf dem Land in Pressbaum oder das kürzlich fertiggestellte Headquarter des traditionellen österreichischen Handelshauses Kiennast.


Ein grüner Platz mit künstlichen Palmen, entstanden aus den Ideen der Nachbar*innen: Das ist der Park Fiction in Hamburg – eine kollektive, partizipative Freiflächengestaltung und Ergebnis der sogenannten „Wunschproduktion“-Methode. Mit dieser Referenz wurde nun im Zuge eines europaweiten Vergabeverfahrens die Büros projektbüro und UVM mit der „Qualifizierung der Hafenkante zwischen Fischmarkt und Landungsbrücken“ beauftragt. Diese Maßnahme markiert den Beginn der ersten Phase der Gestaltung der Freiflächen entlang der wasserseitigen Straße St. Pauli/Fischmarkt und berücksichtigt die bisherigen Ergebnisse, die in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft vom „Park Fiction Komitee“ erarbeitet wurden. Damit tritt das vorangegangene Modellprojekt in einen neuen, repräsentativen Dialog mit Stadt, Bewohner*innen und Planer*innen zur gemeinsamen Gestaltung des öffentlichen Raums am Hafen.
Teilhabe unter Palmen im Park Fiction
Das künstlerische und gesellschaftspolitische Projekt Park Fiction entstand in den 1990er-Jahren aus einer Forderung der Anwohner*innen um den Pinnasberg in Altona-Altstadt und St. Pauli nach einem öffentlichen Park sowie dem Erhalt des ansässigen Clubs „Goldener Pudel“. Das Projekt brachte eine einzigartige Form der Bürger*innenbeteiligung hervor. Die Initiator*innen und Künstler*innen, darunter Mitglieder der PlanBude, starteten die „Wunschproduktion“ als alternativen Planungsprozess. Ab 1995 organisierte die Initiative unabhängig von Politik und Behörden Befragungen, Vorträge und Workshops mit Anwohner*innen und sozialen Einrichtungen wie dem Kinderhaus am Pinnasberg. Ein vor Ort aufgestellter Planungscontainer führte zur vielfältigen Beteiligung aller Altersgruppen. So entstanden Ideen wie ein Seeräuberinnen-Brunnen, ein Open-Air-Solarium oder ein tulpengemustertes Tartanfeld. Die Künstler*innen und Architekt*innen skizzierten diese Vorschläge. Heute ist der Park ein belebter Treffpunkt mit vielfältigen Elementen, betreut vom Park Fiction Komitee und engagierten Mitgliedern. Das besondere Projekt erhielt schnell internationale Aufmerksamkeit und wurde unter anderem 2002 auf der Documenta11 in Kassel präsentiert.

Philosophie der Wunschproduktion
Park Fiction prägte den Begriff der Wunschproduktion als eine radikale Demokratisierung von Planungsprozessen. Durch Fragebögen, Workshops und Diskussionen sollte ein Verfahren etabliert werden, das unabhängig von offiziellen Instanzen die Legitimität und Beteiligung der Anwohner*innen stärkt. Die Initiator*innen verstehen die Wunschproduktion als kollektive Artikulation individueller, subjektiver Sichtweisen, um politische Veränderungen anzustoßen. Im Gegensatz zur bloßen Aktivierung und Diskussion betonen sie die Übersetzung von Wünschen in eine gestaltete Form und konkrete Umsetzung. Die Wunschproduktion-Methode hebt sich von herkömmlichen Ansätzen ab, indem sie individuelle Bedarfe als politisch relevante Äußerungen betrachtet. Sie soll eine neue Sichtweise in der Stadtentwicklung fördern, die Imagination und politische Überzeugungen verknüpft.

Neuer Dialog an der Hafenkante
„Der Uferstreifen gehört der Stadt – also uns allen.“ Mit diesem Ansatz will das Park-Fiction-Komitee, das sich aus der Initiative und dem Planungsteam des Parks herausentwickelte, die Hafenkante in enger Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung weiterdenken. Während der Corona-Pandemie begann das Komitee, die Planung einer Erweiterung des Parks zu untersuchen. Diese Untersuchung wurde auch in die aktuelle Koalitionsvereinbarung der Stadt aufgenommen. Infolgedessen wurde eine europaweite Ausschreibung für die „Qualifizierung der Hafenkante“ durchgeführt, bei der die Büros projektbüro und UVM ausgewählt wurde.
Die bisherige Situations- und Kontextanalyse kartiert und erhebt den sozial-räumlichen Bestand der Hafenkante als Ausgangspunkt für die weitere Prozessgestaltung. Sie umfasst Themen wie Beleuchtung, Zugänglichkeit, Barrieren, Blickbeziehungen und Nutzungen. Aus diesem Analysebaustein werden 1:1 Testungen für die nächste Stufe abgeleitet. Die Stakeholder-Analyse der Planer*innen basiert auf Gesprächen mit diversen relevanten Akteur*innen aus u. a. Verwaltung, Zivilgesellschaft und Gewerbe.
In der bevorstehenden Stufe, die im Sommer 2024 stattfinden wird, soll keine neue Wunschproduktion initiiert werden – der Beteiligungsprozess basiert neben der Analyse auf den Grundlagen früherer Wunschproduktionen. Das hat zum Ziel, Bausteine für zukünftige Interventionen zu liefern und Nutzungsvorschläge gemeinsam mit allen Akteur*innen praktisch zu verfeinern und zu evaluieren. Dabei werden temporäre gestalterische Eingriffe vor Ort genutzt, um Zukunftsvisionen für die Hafenkante zu entwickeln und die Stadtgesellschaft einzubeziehen. Thematische Veranstaltungen, Interventionen und Testungen sollen schließlich ab Sommer dazu dienen, verschiedene Aspekte der Hafenkante zu erkunden und zu diskutieren – und bald eine neue, gemeinsam gestaltete Hafenkante zu schaffen.


Das Gebiet rund um den Mehringplatz im Berliner Stadtteil Kreuzberg gilt als vergessenes Quartier. Leerstand und marode Bausubstanz prägen hier das Straßenbild. Einzig die Friedenssäule mitten auf dem kreisrunden Platz erinnert an die mondäne Geschichte des Ortes, der während des Zweiten Weltkrieges vollständig zerstört wurde. Nach dem Krieg ist hier mit knappen finanziellen Mitteln ein Wohngebiet nach den Maßgaben des sozialen Wohnungsbaus entstanden. 2011 wurde das Quartier als „Sanierungsgebiet Südliche Friedrichstadt“ festgesetzt, das städtebaulich und funktional aufgewertet werden soll. Dass die geplanten und teils schon umgesetzten Maßnahmen kritisch betrachtet werden können und sollten, zeigt die Arbeit des Künstler*innenkollektivs Guerilla Architects. Das fünfköpfige Team hinterfragt die etablierten Prozesse der Stadtentwicklung sowie ihre starren Strukturen und Hierarchien. Am Mehringplatz haben sie in den letzten Jahren mehrere partizipative Aktionen durchgeführt, um die Nachbarschaft zu vernetzen und Sichtbarkeit für die Probleme der Anwohner*innen zu erzeugen.

Interventionen für mehr Aufmerksamkeit
2021 begannen Guerilla Architects mit einer ersten Recherchephase am Mehringplatz. Sie veranstalteten unter anderem an verschiedenen Orten rund um den Platz ein öffentliches Backgammon-Spiel, wodurch sie die Nachbarschaften kennenlernten und erste Kontakte knüpften. Im Jahr darauf arbeiteten sie gemeinsam mit Hebbel am Ufer (HAU) drei Monate lang vor Ort an dem Projekt „mehringplatzen!“. Dabei handelte es sich um eine performative Aktion im Rahmen des „Berlin Bleibt!“-Festivals, die der Rückeroberung des Platzes nach einer Langzeitbaustelle dienen sollte.
2023 folgten drei weitere sogenannte „Irritationen des Alltags“ zur Aneignung des öffentlichen Raums durch die Anwohner*innen. Diese umfassten eine performative Übernahme und Inszenierung des Nachbarschaftscafés „MaDaMe“, ein öffentliches Grappling-Turnier in Kooperation mit einem lokalen Jugendverein sowie eine Nähperformance mit einer lokalen Nähgruppe libanesischer Frauen in Zusammenarbeit mit Musiker*innen. Abschließend gab es eine finale Aktion mit Platzrundgängen und einer Ausstellung im öffentlichen Raum.

Anfängliche Skepsis
Vor allem zu Beginn der Aktionen ist das Team von Guerilla Architects auf Skepsis und Vorurteile seitens der Anwohner*innen gestoßen. Einer der Gründe dafür war, dass das Kollektiv als eine Gruppe Pop-Up-Künstler*innen wahrgenommen wurde, deren Projekte keinen nachhaltigen Nutzen für den Ort haben könnten. Außerdem wurde den Beteiligungsverfahren – etwa den Befragungen – mit Skepsis begegnet. Es hat bereits viele ähnliche Prozesse rund um den Mehringplatz gegeben, bei denen die Wünsche der Anwohner*innen zwar eruiert, jedoch nicht umgesetzt wurden. Dementsprechend musste das Team von Guerilla Architects Überzeugungsarbeit leisten, indem sie sich langfristig vor Ort im öffentlichen Raum engagierten.

Gründung des Revolutionären Anwohner*innen Rats
Im Rahmen Aktionen der Guerilla Architects hat sich am 23. Juli 2023 der Revolutionäre Anwohner*innen Rat (RAR) gegründet. Das erklärte Ziel des Rates ist die Vernetzung der Anwohner*innen, lokalen Gewerbe- und Kulturtreibenden und der Austausch über die Zustände am Mehringplatz und die aktuelle Planungspolitik. Es handelt sich dabei explizit nicht um einen Mieter*innenrat, sondern um eine aktivistische Initiative. Der Rat trifft sich im zweiwöchigen Rhythmus in einem Lokal am Platz und es kommen nach Angaben von Guerilla Architects immer wieder neue Anwohner*innen dazu. Inzwischen ist der RAR auch Teil einer übergeordneten, berlinweiten Vernetzung. Analog zu anderen Initiativen setzt sich der RAR für eine solidarische Nachbarschaft ein.

Künstlerische Forschung als Tool
Guerilla Architects beschreiben ihre Arbeit selbst als performativ-installativ. Mit ihren Projekten und Aktionen wollen sie künstlerische Forschung als ein anerkanntes Tool der Stadtentwicklung etablieren. Sie begreifen Stadtgestaltung als eine transdisziplinäre Aktion und sind Teil des Netzwerks Urbane Praxis Berlin, das sich für die aktive Mitgestaltung der eigenen Stadt durch ihre Bewohner*innen stark macht. Das Kollektiv plädiert für die Etablierung der Urbanen Praxis als neuen Sektor in der Berliner Kultur- und Förderlandschaft.

Natalie Donat-Cattin ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ETH Zürich und Autorin des Buches „Collective Processes. Counterpractices in European Architecture“ (2022), einer ersten umfassenden Analyse von Kollektiven in der europäischen Architektur und Stadtplanung. Im folgenden Gastbeitrag schildert Natalie die Auswirkungen einer neuartigen, horizontalen und transdisziplinären Arbeitsstruktur auf die architektonische Produktion.

Soziale und ökologische Faktoren stellen heutzutage die Architektur und ihre Rolle infrage und fordern Planende dazu auf, den Umfang, Wirkung und Output ihrer Arbeit zu überdenken. Auf diese Dringlichkeiten reagieren neue Arbeitsstrukturen, die als „Kollektive“ bezeichnet werden und durch ihr erweitertes Tätigkeitsspektrum die Grenzen der Architektur ausweiten. Das Ergebnis ist eine neue Sicht auf den Raum und seine Gestaltungsmöglichkeiten – vom Zimmer bis zur Stadt, von der temporären Installation bis zum Kunstwerk, vom materiellen Objekt bis zur immateriellen Forschung.
Das erweiterte Aktionsfeld des Kollektivs
Vielleicht von einer anfänglichen Unmöglichkeit getrieben, steht das Kollektiv vor der Herausforderung, seinen eigenen Aktionsraum zu schaffen: Dieser kann lokal, europäisch oder global sein, abhängig von seiner spezifischen Mission. In diesem alternativen architektonischen Umfeld wächst das Interesse, mit anderen Kollektiven Diskussionen über die architektonische und städtebauliche Praxis und deren etwaiges politisches Engagement anzustoßen. In der Tat werden durch gemeinsame Projekte, Dialoge und Festivals eine Reihe von dichten und weitreichenden Verbindungen zwischen verschiedenen Kollektiven geknüpft, die sich in verschiedenen Online- und physischen Netzwerken oder durch direkte Beziehungen zeigen. Es handelt sich um eine extrovertierte Gemeinschaft, offen für Begegnungen rund um das Architekturprojekt.

Ein kollektives transdisziplinäres Netzwerk
Indem das Kollektiv andere Antworten auf herkömmlich gelöste Probleme findet und den seit langem definierten Prozess des Entwerfens und Bauens infrage stellt, zeigt es sich als zukunftsorientiertes Gebilde. Es ist zudem offen für die Zusammenarbeit mit einem breiteren Netzwerk von Menschen wie Soziolog*innen, Psycholog*innen, Künstler*innen, Bühnenbildner*innen, Choreograf*innen oder Kurator*innen. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Expert*innen ermöglicht es der Architekturpraxis, neue Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und diese aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, sowohl in Bezug auf die Technologie als auch auf die gestalterische Intention. In der Tat wird die geplante oder produzierte Architektur oft durch Theater und Performance beeinflusst und mit sozialem, ökologischem und politischem Aktivismus aufgeladen. Die Architektur wird zu einem Mittel, um den Raum zu besetzen, und nicht zu einem rein formalen Gegenstand.
Niklas Maak betonte diesen Aspekt in seinem Beitrag „A New Approach to Urbanity“, als er über die Projekte des Kollektivs raumlaborberlin schrieb:
„Der utopische Geist der 'bricolage', der all diese Projekte kennzeichnet, zeigt ein neues Verständnis davon, was Architektur sein kann. Anstatt statisch, ewig, unflexibel und teuer zu sein, kann sie abnehmbar und mobil sein, eine Bühne für alle möglichen Szenarien.“ Niklas Maak

Hin zu einer neuen Art des architektonischen Projekts
In diesem Zusammenhang wird eine neue Art des Architekturprojekts möglich. War es in der Vergangenheit immer eine Bauherrschaft, der*die sich an den*die Architekten*in wandte, so ist nun auch der umgekehrte Fall denkbar. Das Kollektiv macht eine mögliche Bauherrschaft auf ein Problem aufmerksam und schlägt gleichzeitig vor, es auf unkonventionelle, manchmal temporäre Weise zu lösen. Man kann dies als das neue architektonische Projekt bezeichnen: Das selbst initiierte Projekt. Diesen Paradigmenwechsel hebt Flavien Menu in seinem Buch „Towards New Commons For Europe“ hervor:
„Nicht auf einen Kunden warten, sondern ihn provozieren. Nicht auf ein Programm reagieren, sondern es schaffen. Den Architekten nicht mehr als Produzenten von Dienstleistungen oder die Architektur als ein Produkt betrachten. Diese alternativen Haltungen [der Kollektive] spiegeln den Wunsch nach Unmittelbarkeit wider.“ Flavien Menu

Natalie Donat-Cattin verfasste den Originaltext auf Englisch, der automatisch übersetzt und redaktionell von baunetz CAMPUS überprüft wurde.
